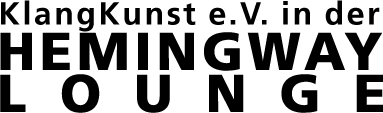„Dann passiert die Musik von allein“
Der Jazz-Saxophonist Peter Lehel wird 60. Er spricht über Coltrane, ungarische Geigen – und darüber, was geschieht, wenn der Kopf des Musikers die Kontrolle aufgibt
Von Wolfgang Janisch
Wer sich in und um Karlsruhe für Jazz interessiert, der kommt an Peter Lehel nicht vorbei. Saxophonist und Komponist, Arrangeur und Bandleader, Dozent, Kurator, Organisator – Lehel ist produktiv und vielseitig, ein Mann für viele Bühnen und Projekte. Am 13. September wird er 60 Jahre alt. Am Abend zuvor feiert er rein: Im Karlsruher Jazzclub gibt er ein „60 Jubilee Concert“ mit Freunden und Weggefährten. Und natürlich hat er eine neue Scheibe rausgebracht: „Paul Auster Jazz“ mit dem Peter Lehel Quartet. Ein Rückblick in Worten.
WJ: Beginnen wir am Anfang: Wie kam Peter Lehel zum Saxophon? Oder das Saxophon zu Peter Lehel?
PL: Meine Oma sagte, der Bub soll ein Instrument lernen, und sie kannte den Klarinettenlehrer bei uns im Dorf. Da war ich sieben oder acht Jahre alt. Drei Jahre später haben sie mir im Musikverein ein Saxophon in die Hand gedrückt. Das hat mir noch mehr Spaß gemacht.
WJ: Also Zufall. Oder Schicksal?
PL: Schicksalhafter Zufall.
WJ: War das Saxophon auch gleich die Entscheidung für den Jazz?
PL: Das hat mit 15 angefangen, nachdem John Coltrane blitzartig in mein Leben getreten war. Ich hatte eine Platte von ihm gehört, „Ballads“. Davor war ein bisschen Klassik und viel Rock, Pink Floyd, Deep Purple, Doors. Mein Bruder, aus dem ein sehr guter Amateur-Gitarrist geworden ist, hatte die Platten. Das hat mich in den frühen Jahren geprägt – aber die E-Gitarre war schon belegt.
WJ: Du hast letztes Jahr die „Coltrane String Ballads“ rausgebracht. Wie viel hat der Peter Lehel des Jahres 2025 mit dem John Coltrane der 60er Jahre zu tun? Sind da noch Verwandtschaften, Spuren erkennbar?
PL: Die frühen Einflüsse sind ja nicht weg. Meine Klangvorstellung wurde stark von Coltrane geprägt. Ich habe damals ein Jahr lang versucht, seine Balladen zu spielen, vermutlich, weil sie mich stark emotional berührt haben. Das war für mich immer etwas Ernstes, Schwermütiges, Gewichtiges. Da war eine größere Dimension drin, die ich als Jugendlicher nicht wirklich verstanden, aber irgendwie gespürt habe. Dieser Bezug zum Klang und ein gewisser Respekt vor der Musik, das ist bis heute in meinem Spiel vorhanden.
WJ: Bei den Ballads hört man die Verwandtschaft zu Coltrane. Bei Love Supreme dagegen, diesen trance-artigen Improvisationen, höre ich das nicht mehr. Das gilt auch für den Sound: Du hast viel mehr Warmtöne drin als der manchmal spröde Coltrane.
PL: Bis Love Supreme bin ist trotzdem voll dabei, und zwar wegen der modalen Spielweise mit den vielen harmonischen Möglichkeiten. Manches davon findet sich im Peter Lehel Quartet wieder. Außerdem habe die Saxophon-Tradition immer nur aus Lernwillen und Interesse nachgespielt. Ich hatte nie die Absicht, wie Coltrane oder Michael Brecker zu klingen.
WJ: Modale Spielweise bedeutet mehr Offenheit für Improvisation, weniger harmonische Leitplanken …
PL: … genau. Coltrane hat in den frühen 60er Jahren letztlich dem Free Jazz den Weg geebnet, obwohl er kein Freejazzer war. Es ist eine Befreiung von funktionsharmonischen Klischees und Zwängen. Man hat einen Leitton, der irgendwo hin muss, und eine lange Strecke, in der eine Modalität und eine Tonalität vorherrscht. Es ist nicht zwingend, dass ein Ton zum nächsten führt. Man ist eher in so einer Klangwolke und findet dort seine Linien, seinen Ausdruck. Coltrane hatte zudem eine sehr starke Expressivität. Das gefällt mir bis heute.
WJ: In den Coltrane String Ballads offenbart sich deine Vorliebe für Produktionen mit Streicher-Ensembles. Ehrliche Antwort: Geigen und Saxophon, passt das wirklich zusammen?
PL: Das passt perfekt zusammen!
WJ: Woher kommt diese Liebe?
PL: Ungarisches Erbe, da kommt mein Vater her. Das stammt aus der noch früheren Kindheit. Ich wollte die Streicher einfach mit Coltrane zusammenbringen – Streichquartett mit Saxophon und eher ernsten Themen. In der Musik geht es immer um Klang. Bei den Ballads verschmilzt der Klang manchmal so sehr, dass man die Instrumente kaum noch auseinanderhalten halten kann.
WJ: Eine Klangsymbiose, eine Annäherung zwischen den Klangwelten?
PL: Ja. Deshalb liebe ich es, mal mit Kirchenorgel zusammenzuspielen, mal mit einem Quintett mit Trompete, mal mit einem Gitarristen oder einem Sinfonieorchester. Oder laut und elektrisch mit einer Rockband.
WJ: Mit dem Kirchenorganisten hast du sogar einen Tango eingespielt und Deep Purple mit dem Saxophon-Quartett. Und es gibt ein Ave Maria von dir, das du auf der Tárogató gespielt hast, einer Mischung aus Klarinette und Saxophon …
PL: …da kommt Ungarn wieder zum Vorschein, dort ist das Instrument sehr populär.
WJ: Ist das immer derselbe Peter Lehel, der da spielt? Oder kommen da verschiedene Facetten der Persönlichkeit zum Ausdruck?
PL: Es gelingt mir ganz gut, mich in andere Musikwelten einzupassen. Als ich zum ersten Mal mit dem Streichquartett gespielt habe, habe ich mich intensiv damit beschäftigt, wie die Instrumente klingen und wo da mein Platz sein kann. Und wie ich mich so anpassen kann, dass die anderen auch auf mich zukommen. Durch die veränderte Umgebung fällt ein anderes Klangbild auf mich. Aber letztlich bin das schon jedes Mal ich selbst. So unterschiedlich spiele ich gar nicht.
WJ: Deine Improvisationen können auf die Zuhörer auch mal disharmonisch wirken. Trotzdem habe ich immer den Eindruck, dass Du eine große Liebe zur Melodie hast, zur schönen Melodie. Du wirst demnächst 60: Ist diese Liebe mit den Jahren größer geworden?
PL: Natürlich gab es Sturm und Drang-Jahre, in denen ich von den technischen Möglichkeiten begeistert war. Da habe ich sicher auch Dinge gespielt, die nicht vordergründig melodisch waren. Eher so: Ich kann auch schnell und kompliziert. Aber eigentlich hat mich schon immer die Melodie am meisten fasziniert. Für mich ist sie die Essenz der Musik.
WJ: Du warst schon viel in der Welt unterwegs – Südkorea und China zum Beispiel. Wie funktioniert dort der Kontakt zum Publikum? Gibt es Unterschiede zu Deutschland?
PL: Das Publikum in den Jazzclubs ist international ziemlich ähnlich, in Asien allerdings deutlich jünger. In Südkorea, wo ich über einen Zeitraum von zehn Jahren immer wieder war, fiel auf, dass das Publikum vor allem aus jungen Frauen bestand. Bildung und Kultur, Theater und Konzert, das war offenbar vor allem den Frauen überlassen. Die Chinesen sind vielleicht etwas lauter. Und die Taiwanesen haben eine ziemlich gute musikalische Allgemeinbildung, die wollen einen ganz bestimmten Musiker hören. Aber der Kontakt zum Publikum ist überall da.
WJ: Jazz ist eine Weltsprache.
PL: So ist es.
WJ: Kommen wir zurück in die Heimat. Ist Karlsruhe eine gute Jazzstadt?
PL: Klar. Den Jazzclub gibt es seit Jahrzehnten. Das Tollhaus ist stark gewachsen. Die Hemingway Lounge hat sich 15, 16 Jahren gut entwickelt. Dazu Tempel und Kohi – viele Bühnen, die sich wunderbar ergänzen. Das Karlsruher Jazzpublikum hat tolle Möglichkeiten. Die sollte man nutzen.
WJ: In Karlsruhe bist du zwei Bühnen eng verbunden. Der Jazzclub im ehemaligen Kinosaal hat eine erhöhte Bühne, die Distanz zum Publikum ist größer. In der Hemingway Lounge musst du aufpassen, dass du den Leuten in der ersten Reihe nicht auf die Füße trittst. Was fühlt sich besser an für den Musiker?
PL: Ich habe tatsächlich zu beiden eine enge Verbindung. In den Jazzclub, damals im Jubez, bin ich schon als 15-Jähriger gegangen. In der Hemingway Lounge, gegründet von Wolfgang Meyer, kuratiere ich seit mehr als anderthalb Jahrzehnten den Freitagabend.
WJ: Der Unterschied für den Musiker?
PL: Ich will nicht werten, was besser ist. Große Bühnen bieten andere Möglichkeiten für größere Ensembles. Aber ich persönlich liebe es sehr, ganz nah am Publikum zu sein. In der Lounge sind Publikum und Musiker auf derselben Ebene – wir sitzen im selben Boot. Das Publikum hat einen starken Einfluss darauf, was auf der Bühne passiert. Und wir, die Musiker, haben eine viel stärkere Verantwortung für das Publikum: Das kann laut werden, wenn du einen Meter vor dem Saxophon sitzt. Ich bin überzeugt, dass die Musik dort noch intensiver sein – weil sie nicht losgelöst vom Publikum passiert. Je weiter weg man steht und je weiter oben, desto mehr spielt man sein Ding. Und je nach Beleuchtung sieht man nicht einmal die Gesichter. Wenn man aber nah dran ist, nimmt man wahr, ob die Zuhörer gerade ihr Handy checken oder doch fasziniert zuhören. Das ist sehr spannend.
WJ: Kommen wir zur Improvisation. Kannst du uns Laien mal erklären, was da passiert? Es ist klar, Du hast ein harmonisches Gerüst, aber das ist nur der Anfang. Wie lange hat das Gehirn die Kontrolle? Und wann übernimmt der Bauch?
PL: Es fängt ja damit an, dass man womöglich mit Musikern auf der Bühne steht, mit denen man noch nie gespielt hat. Wie reagieren die, wie kommunizieren sie mit mir? Da muss man improvisatorisch reagieren können. Improvisation ist eine Technik, eine Sprache. Es ist wie beim Schreiben: Es gibt Leute, die einen sehr großen Wortschatz haben. Oder die, die viele Sprachen sprechen und auf Knopfdruck wechseln können. Das gibt es auch bei den Jazzmusikern. In so einer Situation herrscht eine hochkonzentrierte Bereitschaft, sich auf den anderen einzulassen.
WJ: Wie oft klappt das?
PL: Es gibt Abende, die sind mühsam. Da spielt man mehr Klischees, von denen man weiß, dass sie funktionieren. Das ist eine Art Sicherheitsspiel, das durchaus hohes Niveau haben kann. Und dann gibt es Abende, an denen passieren magische Momente. Und die stellen sich nur ein, wenn man nichts Vorgefertigtes, nichts Konstruiertes spielt. Das passiert, wenn man komplett im Flow ist. Wenn der Kopf nicht mehr dabei ist und ständig überlegt, aha, jetzt mach ich dies und dann jenes. Dann passiert die Musik von allein. Das sind „Golden Moments“, die kann man nicht erzwingen.
WJ: Aber sie kommen vor.
PL: Ich kann nach so einem Konzert nicht gleich ins Publikum gehen und Small Talk machen. Ich möchte den Zustand weiterleben lassen, weil ich da spüre: Das ist der Grund, warum ich mein Leben lang Musik mache. Um diesen Augenblick zu erwischen, der natürlich dann weg ist. Alles was wir tun, ist flüchtig. Das mag manchmal traurig sein, aber andererseits ist das unsere Stärke. Wir sind im Augenblick, und den müssen wir – so gut es geht – ausfüllen. Wenn es gelingt, ist man glücklich.